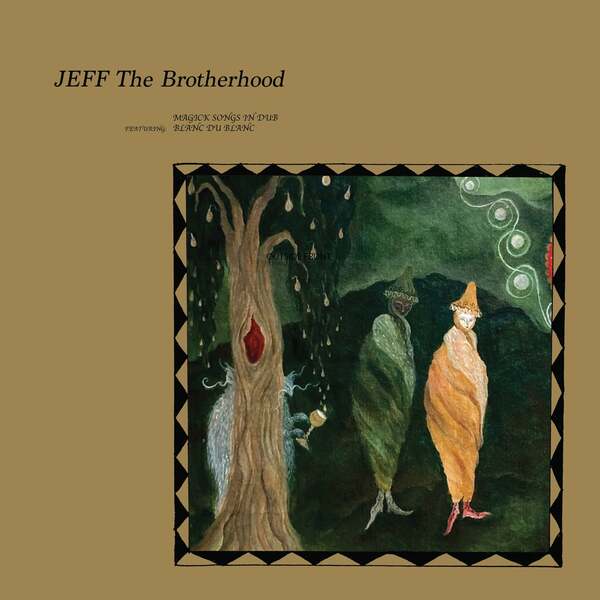Zwischen Bass und Bewusstsein – ein Gespräch mit Neil Perch von Zion Train
Seit über drei Jahrzehnten prägt der Produzent und Aktivist mit seinem Projekt Zion Train die europäische Dub-Szene – und denkt sie gleichzeitig neu. Sein aktuelles Album „Dubs of Perception“ ist mehr als eine musikalische Veröffentlichung: Es ist eine Einladung, tiefer zu hören, genauer hinzusehen und über den Tellerrand genretypischer Reiz-Reaktionsmuster hinauszudenken.
Wenn Neil Perch, Mastermind hinter Zion Train, ein neues Album vorlegt, dann ist das nie bloß ein musikalisches Ereignis. Es ist eine Einladung zum Nachdenken, ein Statement, ein Soundtrack zur politischen Auseinandersetzung. Sein aktuelles Werk „Dubs of Perception“ bildet da keine Ausnahme – im Gegenteil: Es steht exemplarisch für ein künstlerisches Selbstverständnis, das Dub-Musik als kulturellen, sozialen und geistigen Resonanzraum begreift.
„Ich habe mich im Dub-Bereich zuletzt zunehmend gelangweilt“, sagt Perch mit jener unverblümten Klarheit, die ihn auszeichnet. „Früher war Dub aufregend, experimentell, technologisch vorn – heute klingt vieles nach Schema F. Jeder will diesen einen Stepper bauen, der auf dem Sound System explodiert. Das interessiert mich nicht.“ Was ihn interessiert, ist Eigenständigkeit. Echtheit. Klangliche Identität. „Ich liebe es, wenn jede Künstlerin und jeder Künstler den eigenen Ausdruck findet – nicht, um zu gefallen, sondern weil man sich selbst etwas zu sagen hat.“
Für „Dubs of Perception“ kehrte Neil Perch zurück zu den Wurzeln seiner Produktionsweise – zu analogem Live-Mixing. „Ich habe ein 32-Kanal-TAC Scorpion-Pult im Studio – über 40 Jahre alt, aber liebevoll überholt. Ein Gerät, das in Jamaika viel verwendet wurde – unter anderem bei Mikey Bennett im Music Works Studio.“ Die Entscheidung für das analoge Setup war nicht nostalgisch, sondern eine bewusste Abkehr vom Übermaß an digitalen Möglichkeiten: „Ich hatte einfach genug davon, alles im Rechner zu machen. Ich wollte zurück zu einer Arbeitsweise, in der Überraschung und Spontaneität möglich sind.“ Spontaneität, das meint bei ihm nicht Chaos, sondern musikalische Intuition. „Wenn ich analog mische, ist alles impulsiv. Ich richte die Effekte ein, drücke Play – und dann fließt es. Ich folge dem Vibe. Ich kann nichts planen. Und genau das liebe ich. Ich überrasche mich dabei selbst.“
„Für mich ist Dub nicht einfach eine Stilrichtung – es ist eine Herangehensweise an Musik“, sagt er und lehnt sich nachdenklich zurück. „Ich sehe das Mischpult als Instrument. Wenn ich live dubbe – und damit meine ich das Mischen in Echtzeit im Studio, auf dem analogen Mischpult –, dann ist das ein performativer Akt. Ich spiele das Mischpult wie andere ein Schlagzeug oder eine Gitarre.“ Die Arbeit mit dem TAC Scorpion ist für ihn ein bewusster Gegenentwurf zur computergesteuerten Produktion. „Ich könnte alles automatisieren, Filterkurven vorausplanen, die Effekte perfektionieren. Aber das ist nicht mein Weg. Ich will im Moment entscheiden – mit den Händen, dem Ohr, dem Bauch. Ich will, dass der Mix atmet.“
Diese Herangehensweise zieht sich durch das gesamte Album. „Ich bereite vieles vor: Spuren, Effekte, Routings. Aber sobald ich Play drücke, ist alles offen. Ich habe eine Idee, aber keine Kontrolle. Und genau das liebe ich. Ich will, dass etwas Unerwartetes passiert. Wenn ich beim Dubben selbst überrascht werde, ist das ein gutes Zeichen. Das liebe ich – diese Spannung zwischen Routine und Zufall.“
Beim Dubben ist er in Bewegung. „Ich greife zu den Fadern, drehe die Aux-Sends, schiebe Delay-Trails auf und ab, ziehe den Bass raus, dann wieder rein. Das ist körperlich. Und es hat mit Präsenz zu tun – ich bin voll da, in diesem Moment, in diesem Klang.“
Er lacht kurz: „Viele halten Studioarbeit für steril. Aber das ist Unsinn. Wenn ich einen Dub mixe, bin ich genauso emotional involviert wie auf der Bühne. Vielleicht sogar mehr. Der Unterschied ist nur: Es schaut mir niemand dabei zu.“ Und dann wird er wieder ernst: „In einer Welt, die immer stärker auf Kontrolle, Präzision und Wiederholbarkeit setzt, ist diese Form des Arbeitens ein Statement. Ich lasse Raum für Fehler, für Unschärfe, für Instinkt. Für das Menschliche. Ich glaube, das ist ein Grund, warum viele digitale Produktionen so leblos klingen – weil sie zu glatt sind. Ich will keine Perfektion. Ich will Wahrheit im Klang.“ Ein weiterer neuer, alter Klanggeber ist die TB-303, jene sagenumwobene Acid-Machine von Roland. „Ich habe ein modernes analoges Modell im Studio – dieser Sound ist wieder da, nicht nur wegen der Nostalgie, sondern weil ich diese Art von Klang einfach spannend finde.“
Doch so sehr er über Ästhetik und Produktionsweisen spricht – sein eigentliches Anliegen geht weit darüber hinaus. Die Musik von Zion Train ist durchzogen von Philosophie, Kulturgeschichte und politischem Bewusstsein. Jeder Songtitel, jeder Albumname ist ein Verweis, eine Einladung zum Weiterdenken. „Dubs of Perception bezieht sich direkt auf Aldous Huxleys The Doors of Perception. Es geht um Wahrnehmung, Bewusstsein – um das, was wir sehen, wenn wir die Perspektive verändern.“ Der Track „Cosmic Serpent“ verweist auf Jeremy Narbys Buch über Schamanismus, Ethnografie und Psychopharmakologie. Und „Népantla“ greift ein Konzept aus der Nahuatl-Kultur auf: „Es bezeichnet den Zwischenraum – zwischen zwei Kulturen, zwei Identitäten, zwei Realitäten. Das ist ein zentraler Begriff für mein Leben. Ich bin ein brauner Mann, geboren in England, lebend in Deutschland, mit karibischen Wurzeln. Ich existiere in diesem Dazwischen.“
Diese Idee prägt auch seine Musik: Sie ist nicht Reggae, nicht Techno, nicht Dubstep, nicht Ambient – und doch durchdrungen von all dem. Musik in Bewegung. Hybrid, aber nie beliebig. Was er dabei radikal ablehnt, ist das Kopieren. „Ich lasse mich inspirieren – vom Vogelgesang genauso wie von Techno. Aber ich kopiere nicht. Plagiarismus ist ein Verbrechen gegen die Kunst. Selbst wenn nur zwei Leute mein Stück mögen – wenn ich es selbst liebe, ist es ein Erfolg.“
Seit jeher tourt Zion Train mit eigenem Sound System – auch wenn das heute seltener wird. „2002 habe ich mein System nach Deutschland gebracht. Damals gab es nur wenige Anlagen mit richtigem Druck. Heute gibt es Sound Systems in jeder Stadt, von Polen bis Spanien, von Norwegen bis Sizilien.“
Doch der Erfolg des Movement bringt auch Schatten: „Mit der Verbreitung kam die Uniformität. Zu viele Tracks klingen gleich. Ich mag keine Musik, die auf Effekt gebürstet ist. Ich will Emotion, Tiefe – keine Drops fürs kollektive Durchdrehen.“
Emotion und Tiefe – beides findet sich reichlich auf „Dubs of Perception“. Auch, weil Perch Musik nie von Politik trennt. „Alles, was ich tue, ist politisch. Ob ich Fahrrad fahre oder Auto. Ob ich Bio kaufe oder Billigfleisch. Ob ich Nachrichten bei ARD oder bei Al Jazeera schaue – alles sind politische Entscheidungen.“ Er bezieht Stellung. Nicht mit Slogans, sondern durch Haltung. „Ich bin Antikapitalist. Anarchist im Sinne von selbstorganisierter Gesellschaft. Ich glaube, dass Menschen sich um ihre Gemeinschaften kümmern können – wie es die Black Panthers in den 1970er-Jahren getan haben: kostenlose Frühstücke, Alphabetisierung, medizinische Versorgung. Nicht, weil der Staat es sagt, sondern weil es nötig ist.“ Dabei schreckt er auch vor unbequemen Aussagen nicht zurück. „Es gibt Dinge, über die man in Deutschland kaum sprechen darf – zum Beispiel die israelische Politik. Wenn ich sage, dass es Unrecht ist, Kinder in Gaza zu bombardieren, werde ich als Antisemit diffamiert. Aber das ist falsch. Ich kann für die Existenz Israels sein – und trotzdem gegen Kriegsverbrechen. Ich kann jüdische Menschen schätzen – und trotzdem gegen Kolonialismus sein.“
Die gesellschaftliche Analyse, die er liefert, ist messerscharf: „Das Problem ist nicht Migration. Das Problem ist Kapitalismus. Die Dörfer veröden, der Nahverkehr stirbt, Menschen sind überfordert – und man gibt Migranten die Schuld.“ Dabei brauche Deutschland Zuwanderung: „Jährlich 400.000 Menschen, sonst bricht das System zusammen. Aber was fehlt, ist eine kluge, empathische Integrationspolitik. Die Angst der 70-jährigen Dorfdeutschen ist genauso real wie die Verzweiflung des 22-jährigen Syrers. Beide brauchen eine Bühne für ihre Stimme. Aber statt Gespräch gibt es Parolen.“ Er plädiert für offene, vorurteilsfreie Debatten. Für mehr Zuhören. Für mehr Mut, unbequeme Fragen zu stellen. Und eine neue Wertschätzung für das, was wirklich zählt: „Es kann nicht sein, dass der Mann, der Rheinmetall-Aktien kauft, mehr Anerkennung bekommt als die Frau, die Kinder im Kindergarten betreut. Das ist krank.“
Ein weiterer Einflussfaktor in seinem Leben: die Vaterschaft. „Früher war ich fünf Tage die Woche im Studio. Heute verbringe ich weniger Zeit dort – aber viel intensiver. Ich entwickle Ideen im Kopf, bringe sie gezielt ins Studio, arbeite effizienter.“ Doch die Rolle als Vater beeinflusst nicht nur den Alltag, sondern auch das Herz. „Es gibt Tracks, bei denen ich beim Hören weine. Ich weiß nicht warum – aber es überkommt mich. Die einzige andere Sache im Leben, die solche Gefühle in mir auslöst, ist die Liebe zu meinen Kindern.“
Für Perch ist Musik kein Konsumgut, sondern Medizin. „Musik ist Magie. Sie heilt. Sie verbindet. Sie gehört uns allen. Und wenn sie zur Ware degradiert wird – durch Plattformen wie Spotify oder durch KI-generierte Songs –, dann wird diese Magie missbraucht.“ Dabei ist ihm bewusst, dass die Realität dieser Kommerzialisierung nicht aufzuhalten ist. „Spotify ist ein geniales System – aber in den Händen eines Kapitalisten, Daniel Ek, der sich für nichts außer Profit interessiert. Ich höre privat kein Spotify. Ich will diesem Mann keinen Cent geben.“
Was bleibt nach zwei Stunden Gespräch mit Neil Perch, ist das Bild eines Künstlers mit Haltung. Eines Menschen, der sich nicht abfindet mit der Welt, wie sie ist. Der Musik macht, nicht um zu flüchten, sondern um zu kämpfen. Gegen Lethargie. Gegen Beliebigkeit. Für Bewusstsein, Empathie und Veränderung. Sein Dub ist kein Echo der Vergangenheit. Er ist ein akustisches Zukunftsmanifest.