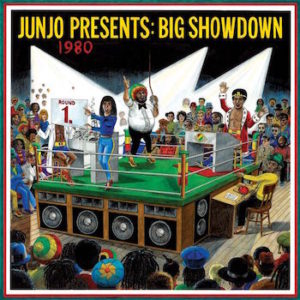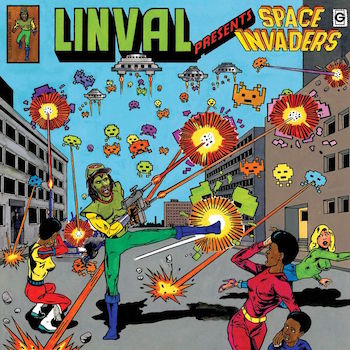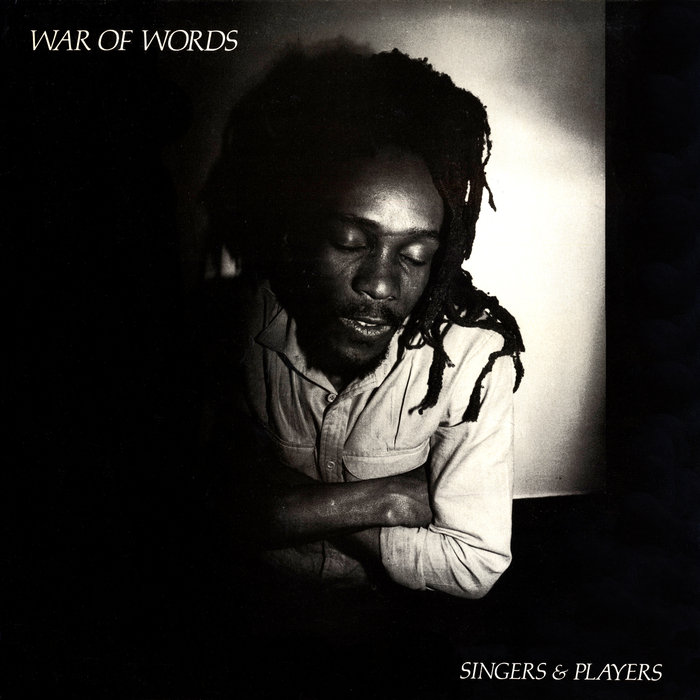Oha, was ist das denn? Da mokiere ich mich an dieser Stelle stets über einfallslose Steppers-Klischees (obwohl diese ja von Zeit zu Zeit und am richtigen Ort auch gerade recht sein können) und fordere mehr Experiment, mehr Überraschung, mehr Freidenkertum – und dann das! Ein Album, das diese Forderung absolut ernst nimmt. Das mit allem bricht, was typischerweise Dub ausmacht. Das Konventionen radikal hinterfragt, sich um Genre und Stil nicht schert, beherzt musikalische Grenzen überschreitet und überhaupt alles anders macht, als man es erwarten würde. Oder anders ausgedrückt: Das neue Werk von Aldubb ist entweder ein geniales Konzeptalbum oder verkopfter Murks. „A Timescale of Creation – Symphony No. 1 in Dub minor“ (Feingeist Records), lautet der komplette Titel und demonstriert den verrückt hohen Anspruch des Albums. Eine Reise durch Raum und Zeit des Universums, vom Urknall, den Sekundenfragmenten danach, über unsere aktuelle Existenz bis in eine ungewisse, aber optimistisch erscheinende Zukunft – in Dub, versteht sich. Die 13 Tracks des Albums fließen nahtlos ineinander, ergeben ein einziges 42 Minuten langes Stück, eine Dub-Symphonie aus subsonischen Bassfrequenzen, donnerndem Wobble-Bass, elektronischen Sound-Wolken, klassisch-symphonischen Streichern, fein dosierten Klarinetten- und Posaunenklängen und – man glaubt es kaum – ganz normalen Reggae-Beats. Creation Rebels „Starship Africa“ trifft auf Hey-O-Hansen, trifft auf Matthias Arfmann, trifft auf Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“. So etwas kann verdammt leicht in die Hose gehen. Zwar würde die Kritik positiv darüber zu schreiben, denn Kunst hat gegenüber profaner Unterhaltung immer einen Bonus. Aber nicht selten wäre das hochgelobte Werk tatsächlich langweilig. Es gehörte zwar in eine gepflegt-anspruchsvolle Sammlung, würde aber eigentlich nie freiwillig aufgelegt. Wie anders ist es hier! Aldubbs Exkursion durch die obskure Geschichte unseres Universums und in unsere noch viel obskurere Zukunft, ist mit jedem Takt unterhaltsam, packend und einfach unglaublich schön. Das Verhältnis zwischen neuen, verstörenden (dafür aber um so spannenderen) Reizen auf der einen Seite und soliden, wohlvertrauten Beats und Harmonien auf der anderen, stimmt exakt. Es ist unmöglich, sich der Faszination dieser akustischen Reise zu entziehen. Und wer beim Hören nicht zumindest eine Ahnung davon bekommt, was Dub, über das bekannte Konzept hinaus, noch alles mehr sein kann, muss entweder taub oder borniert sein. Aldubb stößt hier eine Tür zu einer neuen Dimension von Dub auf. Gehen wir hindurch!

![]()