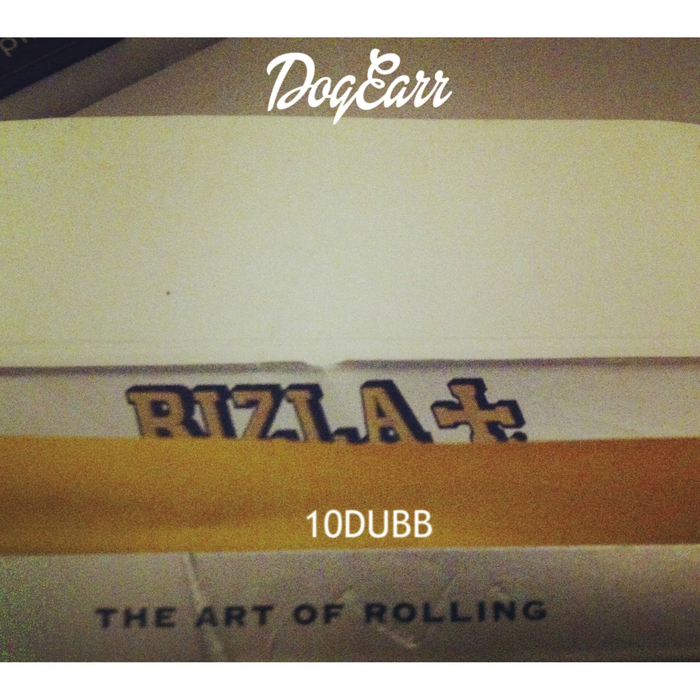Nick Manasseh ist auch einer meiner großen Dub-Heroen. Schon in den 1990ern war ich hin und weg von seinen hoch innovativen und schlicht wunderschönen Dub-Produktionen. Man erinnere sich z. B. an das grandiose „Dub The Millennium“ oder an seine Produktion für die Brasilianer Cool Hipnoise, deren Album „Showcase & More“ 2003 auf Echo Beach erschienen war und das ich gefühlt mindestens 200 mal gehört habe. Wer nicht so weit zurück denken mag, sollte sich einfach auf dem Label „Roots Garden“ umhören, um in Nicks fantastische Welt des Roots & Dub einzutauchen. Seine neuste Produktion ist das Showcase-Album „All a We“ (Roots Garden) für Brother Culture. Während der DJ-Veteran aus Brixton hier sechs schöne Old-School-Style-Toasts zum besten gibt, wollen wir unser Ohr lieber mal den darunter liegenden Produktionen – und insbesondere den sechs Dub-Versionen – leihen. Tja, und was es da zu hören gibt, ist einfach mal wieder wahnsinnig gut. Wie macht der Mann das nur? Seit 30 Jahren produziert er Reggae und Dub – und zwar stets an vorderster Front des Genres. Seit „Dub The Millenium“ 1993 von Acid Jazz lizensiert wurde, hat Nick seine Pole-Position inne. Wie keinem anderen Dub-Produzenten ist es ihm gelungen, am Puls der Zeit zu bleiben, sich selbst und die Musik stets zu erneuern und voraus zu denken, statt irgendwo in der Vergangenheit stehen zu bleiben (wie z. B. Mad Professor), sich zu wiederholen (z. B. Deadzone), oder sich in scheininnovative Kopfgeburten (z. B. Adrian Sherwood) zu flüchten. Dabei klingen die Produktionen von Nick selten spektakulär, sind niemals selbstgefällig oder aufmerksamkeitsheischend. Ganz im Gegenteil kommen sie eher unauffällig und selbstverständlich daher. Oft ist man schon mitten im Song, bevor einem dieser durch heftiges eigenes Kopfnicken überhaupt erst richtig bewusst wird. Statt mit großer Geste „Hier, hier!“ zu rufen, schleichen sich Nicks Produktionen in den Körper und versetzen ihn in Bewegung. Der Groove hat genau die richtige Körpertemperatur. Man versinkt in ihm, wie in wohl temperiertem Badewasser. Der Sound ist klar und kraftvoll, die Kompositionen perfekt strukturiert und arrangiert. „All a We“ ist deshalb aus meiner Sicht eines der besten Alben des laufenden Jahres.
![]()