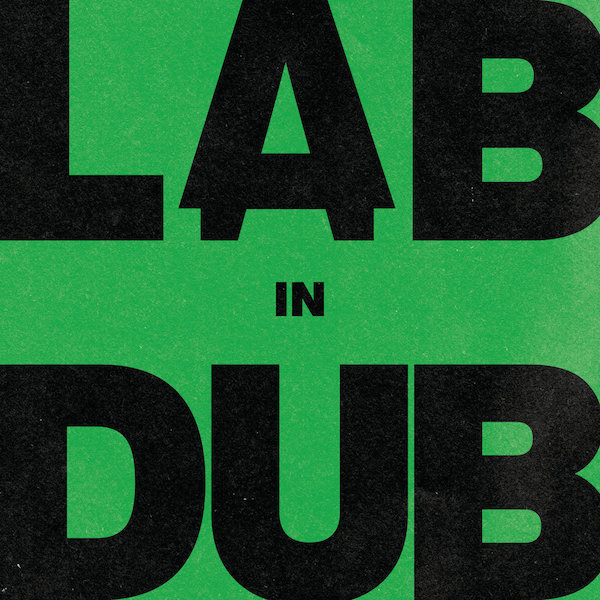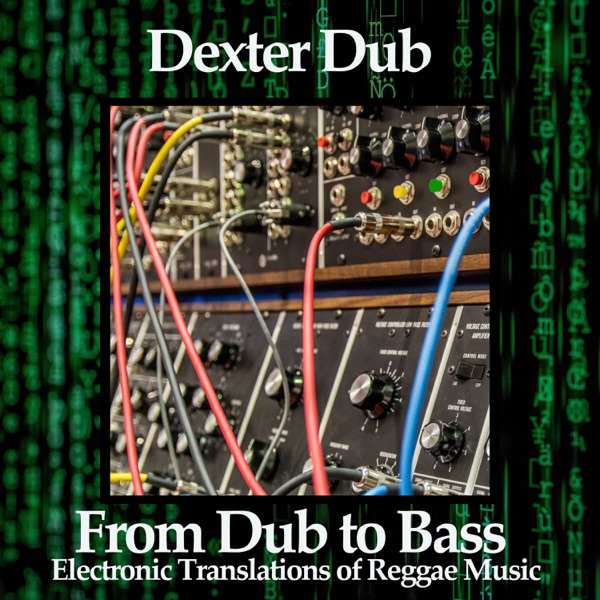Vocal first, dub second (if at all), so lautet das Motto für die meisten Dub-Werke. Diese Reihenfolge ist ja auch logisch. Der Dub wird ja bekanntlich aus einem Vocal-Original gemischt, muss also zwangsläufig an zweiter Stelle stehen. Die meisten Bands und Produzenten lassen sich mit dem zweiten Schritt Zeit. Viel Zeit. Kommerziell macht es kaum einen Unterschied, da das Dub-Album sowieso nur von einer sehr, sehr kleinen Hörerschaft goutiert wird. Doch es gibt sie noch, die Bands und Produzenten, die diese Praxis mißachten und dem Dub einen gleichrangigen Stellenwert wie dem Original einräumen. Als da wären: die Soothsayers und Victor Rice. Das neue Instrumentalalbum der Band „Soothsayers Meets Victor Rice and Friends in Dub“ (Red Earth Music) erschien zeitgleich mit „Soothsayers Meets Victor Rice and Friends“. Zwei grandiose Alben, die eigentlich gleichermaßen in diese Kolumne passen, denn das „Original“ ist ein reines Instrumentalalbum.
Die Soothsayers sind eine britische Band mit Sitz in London. Sie wurde 1998 von zwei Blechbläsern gegründet (Idris Rahman und Robin Hopcraft) und verschrieb sich Ska, Reggae und Afrobeat. Sounds, denen sie bis heute treu geblieben ist. Entsprechend wird ihre Musik dominiert von kraftvollen Bläsersätzen, meist schnellen Shuffle-Beats, vielen Jazz-Einflüssen und generell einem sehr analogen Studio-Sound. Wenig überraschend also, aber von absoluter Perfektion und unbändiger Spielfreude. Vor allem die Jazz-Anleihen sorgen für eine schön komplexe Struktur, die kongenial zum repetitiven Rhythmus kontrastiert. Wohltuend ist auch, dass sowohl die Geschwindigkeit der Beats, wie auch die Arrangements von Stück zu Stück stark variieren. So wird das Instrumentalalbum zum richtigen Hörerlebnis.
Das Dub-Pendant addiert noch den Remix-Layer hinzu. Aber natürlich zeichnet sich guter Dub durch eine clevere Reduktion auf das Wesentliche aus. Produzent und Remixer Victor Rice weiß das natürlich und eliminiert folgerichtig mehr als er addiert. Rice ist ohne Zweifel exakt er richtige Man für diesen Job. Sozialisiert wurde er als Bassist, Sound-Engineer und Produzent in der New Yorker Ska-Szene der 1990er und 2000er Jahre. 2002 emigrierte er nach São Paulo in Brasilien, gründete seine eigene Band, produzierte und remixte unzählige Alben (u. a. wurde er einer der wichtigsten Produzenten bei Easy Star Records) und befasste sich insbesondere intensiv mit Dub. Letzteres ist für einen Ska-Musiker eine recht ungewöhnliche Entscheidung, ist Ska doch eine Musik, die aufgrund ihrer Geschwindigkeit kaum Platz für Dub lässt. Nun, Victor Rice machte aus diesem Dilemma seinen USP und steht seit etlichen Jahren für faszinierende Dub-Versionen von Ska oder Ska-beeinflusster Musik. Deshalb taucht sein Name im Dubblog auch regelmäßig auf.
Auf „Soothsayers Meets Victor Rice and Friends in Dub“ liefert er wieder ein Paradebeispiel seiner Kunst. Seine Dub-Mixes fügen sich organisch in die komplexe Struktur der Instrumentals und erschaffen eine gänzlich neue, originelle Interpretationen der Originale. Das Dub-Album hat eine gänzlich andere Tonalität, als das Instrumentalalbum. Während letzteres einem Feuerwerk gleicht, ist die Dub-Version eher ein Lagerfeuer, an dem man sich wärmen kann. Konzentration und Introversion statt überbordendem Temperament und hemmungsloser Extroversion. Beides hat seinen Reiz, aber wir Freunde des Dub neigen naturgemäß eher zum Weniger, als zum Mehr (nur beim Bass ist es anders herum ;-). Übrigens wäre Victor nicht Rice, wenn er nicht auch schon einige der Instrumentals mit sanften Dub-Effekten ausgestattet hätte. Daher bleibt nur die Empfehlung: Streamt einfach beide Alben!