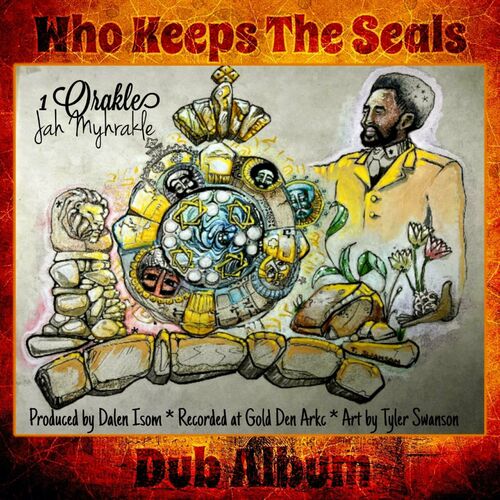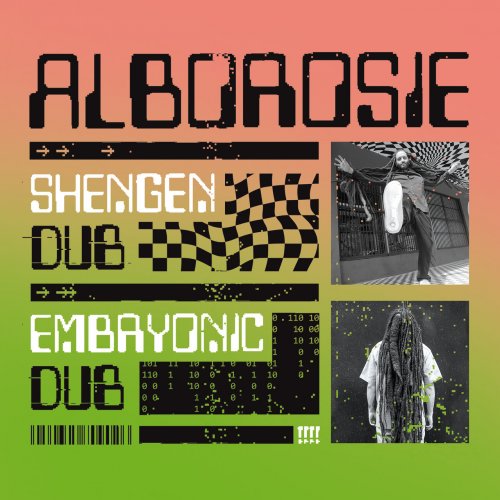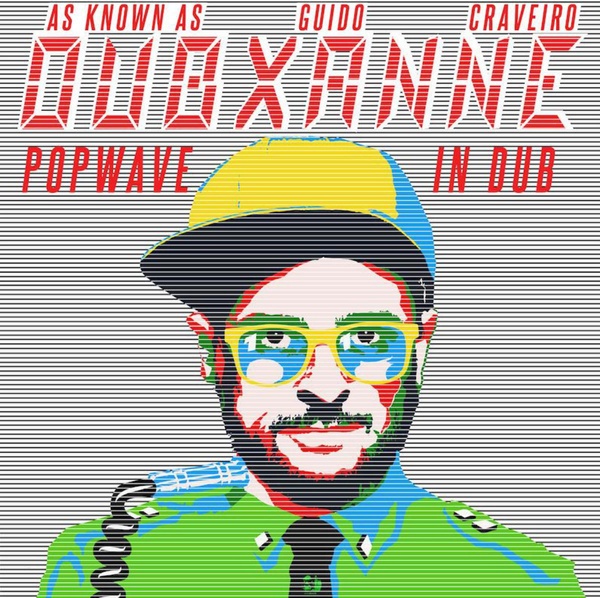Was erwartet man wohl von einem Album, bei dem sich Lone Ark, Zion High und I Grade (sprich: Roberto Sanchez, David Goldfine und Laurent Alfred) die Hand geben? So ziemlich die Roots-Granate schlechthin – noch dazu wo es sich um den neuen Release von Ras Teo handelt, der mittlerweile vom Rezensenten und – wie man hört – in der Community geschätzt wird. Und das Teil gibt’s kommt auch noch mit feinster Artwork: einem klassischen Portrait des Kaisers von Äthiopien – wann hat man sowas zuletzt in solch‘ schöner Aufmachung gesehen?

Deshalb geich vorweg: Ras Teo’s neuer Release „Ion Man in Dub“ (Forward Bound Records) und das entsprechende Vokal-Album „Ion Man“ erfüllen durchaus die hohen Erwartungen: Die Produktion ist 1A – nicht weichgespült wie so manche neuere I-Grade Produktion, sondern schön griffig; sie bedient sich klassisch anmutenden Arrangements und kann mit Extras wie feinen Bläsersätzen und wunderbaren Querflöten-Passagen aufwarten. Auch David Goldfine‘s dynamischer Dub-Mix ist gediegenes Handwerk – ohne zukunftsweisende Gimmicks, aber einem Echo, das reichlich eingesetzt und punktgenauer nicht sitzen könnte; der Hall unterstützt die passenden Passagen wohldosiert. Kurzum: Allein produktionstechnisch wäre das Ganze schon ein Fall für eine 5-Sterne-Rezension, wenn… ja wenn da nicht die Fade-outs wären. Die sind ja wohl mittlerweile ein No-go, wer macht die noch? Gerade bei Dub-Tunes sind Fade-outs eine Schande, wo sich doch Effekte en masse anbieten, um einen dubbigen Schlussakkord zu setzen. Also bitte: Das muss nun wirklich nicht mehr sein.
Wir beschäftigen uns hier zwar mit Dub, ich möchte aber trotzdem eine Lanze für das Vokal-Album „Ion Man“ (Forward Bound Records) brechen: Nicht nur Ras Teo’s samtweicher Gesang hat sich weiterentwickelt – man beachte etwa die wunderbar übereinander gelegten Backing-Vocals; auch sein Songwriting hat ein neues Niveau erreicht und langt schon an das von Ijahman Levi heran. Als eindrucksvolles Beispiel sei der Track „Hard Fe Ketch“ genannt, der ebenso gut auf einem Ijahman-Album hätte erscheinen können. Auch hier: 5 Sterne-Material, wenn… ja wenn da nicht wieder die ungeliebten Fade-outs wären, siehe oben: No-go.
Unter’m Strich haben wir’s mit zwei feinen Roots-Alben zu tun, die süchtig machen und beim Rezensenten zur Zeit gefühlt rund um die Uhr laufen. „Ion Man in Dub“ ist aktuell leider nur eingeschränkt über bandcamp erhältlich; das Vokal-Album „Ion Man“ hingegen hat den großen Release erhalten und ist quasi auf allen digitalen Plattformen zu finden. Sämtliche Daumen hoch für beide Releases – aber ein kleiner Sterne-Abzug für obiges Ungemach.