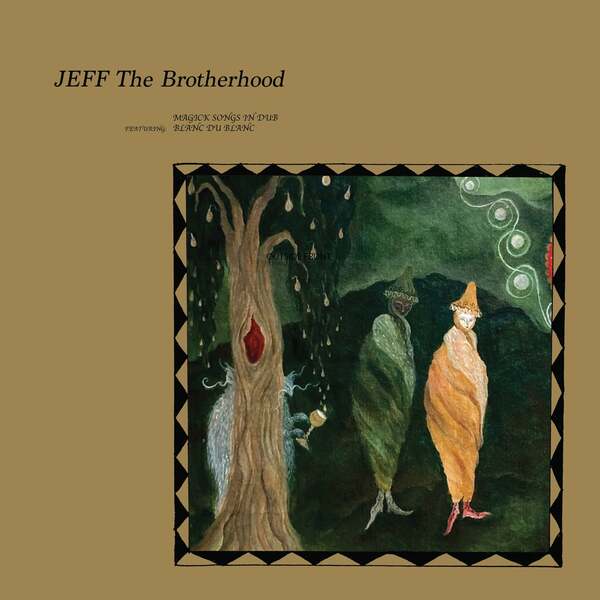Wie in den Kommentaren zu den „Charts 2025“ bereits angeklungen, ist schon etwas Wahres dran, dass im Jahr 2025 viele ziemlich gute Dub-Alben erschienen sind. Teilweise war es eine riesige Flutwelle, die über unsere Dubheads hinweg geschwappt ist. Und deshalb wäre beinahe das „Balkan Dub System” mit seinem gleichnamigen Album in der Flut von mir unbeachtet untergegangen. Hätte ich gewusst, dass sich hinter dem „Balkan Dub System” ein neues Projekt des sehr umtriebigen und vielseitigen kroatischen Multiinstrumentalisten Ognjen Zecevic alias Egoless verbirgt, wäre mir das nicht passiert. Egoless ist seit 2007 in der Musikbranche tätig. Zunächst trat er der Band Stillness aus der Region Split-Zagreb bei. Danach folgte fast zwanzig Jahre eine beeindruckende Laufbahn in der globalen Bass-, Dub- und Dubstep-Szene. Auch seine Auftritte beim Seasplash in Istrien oder in einigen der besten Clubs Großbritanniens sowie eine Tour durch amerikanische und kanadische Städte machten ihn über den Atlantik hinweg bekannt. Mit seinem Album „Dubternal“ landete er beim renommierten britischen Soundsystem-Label Deep Medi Musik, das von Londons führendem Dubstep-Innovator Mala von Digital Mystikz betrieben wird. In Kroatien wurde „Dubternal“ mit dem Elektor und Ambasador für das Album des Jahres ausgezeichnet.
Kurz nach all den Auszeichnungen reifte bei Egoless bereits ein neues Konzept. Dieses entstand exakt an der Schnittstelle zwischen Ost und West mit seiner turbulenten Geschichte, komplexen Vergangenheit und fahrenden Völkern. Der Balkan war schon immer ein Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen, geprägt von Jahrhunderten der Migration, Konflikten und des regen Austauschs. Aus dieser Vielfalt von Traditionen, Sprachen und Religionen entstand der Raum für Egoless‘ neue musikalische Vision. Daraus resultierte ein Album mit sieben Tracks, das tief in den musikalischen Traditionen des Balkans und des Nahen Ostens verwurzelt ist. Das neue Projekt und gleichnamige Album von Ognjen Zecevic „Balkan Dub System” kombiniert geschickt Roots Dub, Oriental Dub und Weltmusik zu einer akustischen Fusion mit den traditionellen Instrumenten des Balkans, darunter Saz, Santur, Duduk, Ney, Kaval, Darbuka und Bendir. Als einziger zusätzlicher Musiker spielte Roko Margeta auf der türkischen Ney und der mazedonischen Kaval, während alle anderen Instrumente von Egoless selbst eingespielt und gemischt wurden.
Ok, solche Projekte sind nicht völlig neu. Wir kennen ähnliche Klänge von Moreno Visini alias The Spy from Cairo, dennoch gefällt mir das vorliegende Album ausgesprochen gut. Auch, weil es einfach etwas Besonderes ist.